<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS>
<IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK>
<NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK>

| Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 1 | HU ISSN 1419-1652 |
<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS> <IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK> <NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK> |  |
Schriften der GEWISOLA........
Perspektiven der agrarsektoralen Entwicklungen in den MOE-Staaten; Notwendigkeit eines differenzierten Analyseansatzes
von
Jochen Köckler und Andreas Quiring*
Seit dem Beginn des Transformationsprozesses unterliegen die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen in den MOE-Staaten auf dem Weg von der zentralistischen Planwirtschaft zu mehr marktwirtschaftlich ausgeprägten Wirtschaftssystemen weitreichenden Veränderungen. Als typische Anpassungsreaktionen innerhalb der Agrarsektoren konnten bisher beispielsweise ein Abbau der Viehbestände, tendenziell sinkende Outputniveaus und eine geänderte Funktion der Preise identifiziert werden. Zu welchen Teilen diese Entwicklungen einzelnen Einflußfaktoren zuzuordnen sind oder sich gegenseitig beeinflussen, kann anhand partieller Betrachtungen aber kaum beantwortet werden.
Zeitgleich zu diesen Veränderungen im landwirtschaftlichen Produktionsbereich erfolgten institutionelle Umstellungen in vielen Bereichen der statistischen Erfassung. Diese Anpassungen sind im wesentlichen durch unterbrochene Datenflüsse und die Bestrebungen zur Anwendung der EU-Methodik bedingt.
Vor diesem Hintergrund und einem ständig wachsenden Informationsbedarf in den MOE-Staaten und der EU, speziell im Hinblick auf die nahenden Beitrittsverhandlungen, wurde mit der Entwicklung eines Politik-Informationssystems für die Agrarsektoren der Transformationsländer (PIT) begonnen. Der Startpunkt zur Umsetzung dieses Informationssystems erfolgt in einem Teilbereich des EU finanzierten FAIR-Projektes "Agricultural Implications of the CEEC Accession to the EU". In diesem Informationssystem werden zunächst Daten aus unterschiedlichen Quellen in einem aktivitätsanalytisch differenzierten Gesamtrechnungsansatz zusammengeführt. Währenddessen werden unterschiedliche Konsistenz- und Plausibilitätsprüfungen vorgenommen, um den Schwierigkeiten der Informationsgewinnung entsprechend der zuvor skizzierten Ausgangslage gerecht zu werden. Die Berechnung von Einkommensindikatoren und die Abbildung agrarsektoraler Verflechtungen in einem Sektoralen Basismodell bilden anschließend die Grundlage für Prognose und Simulation zukünftiger landwirtschaftlicher Entwicklungen in den Transformationsländern.
Mit der Erstellung des Informationssystems PIT sollen folgende Ziele erfüllt werden:
Das Informationssystem wird modular aufgebaut und in drei Teilbereiche unterschieden:
Im Sektoralen Basismodell erfolgt die geschlossene Ex-post Abbildung der agrarsektoralen Produktionsstrukturen und der intra- und intersektoralen Interdependenzen (Produktbereichprinzip) unter Berücksichtigung der physischen und monetären Konsistenz. In diesem Modul werden die vier erstgenannten Ziele (siehe Kap. 2.1) umgesetzt.
In den darauf aufbauenden Teilbereichen werden Politiksimulationen durchgeführt. Das
Konsistenzrahmenmodell dient dazu, Indikatoren, Experteneinschätzungen, Ergebnisse partieller Analysen und endogene Anpassungsreaktionen zusammenzuführen, um mit diesen Parametern die Auswirkungen verschiedener Rahmenbedingungen auf die Produktion und das Einkommen des Agrarsektors zu analysieren (Monitoring und Wirkungsanalyse).
Im Agrarsektormodell werden diese exogenen Parameter durch endogene Substitutionsbeziehungen zwischen Produktion und Faktoreinsatz ersetzt, wenn hierzu ausreichend abgesicherte Erkenntnisse vorliegen. Für das Agrar- und Umweltinformationssystem RAUMIS, ein Agrarsektormodell für Deutschland, wird in einem weiteren Tagungsbeitrag (Cypris, Kreins, 1997) diskutiert, ob es sich um einen Prototyp für die MOE-Staaten handeln könnte.
Zum bisherigen Bearbeitungszeitpunkt befindet sich das Sektorale Basismodell im Status der Verbreiterung der Datengrundlage im Rahmen des FAIR-Projektes, während mit dem Konsistenzrahmenmodell explorative Anwendungen durchgeführt werden.
Als methodischer Hintergrund des Informationssystems dient der prozeßanalytisch differenzierte Gesamtrechnungsansatz. Mit diesem Analyseansatz wird der Agrarsektor in verschiedene Produktions- und Verwendungsaktivitäten differenziert. Grundlage dieser Abbildung ist ein tabellarisch aufgebauter Konsistenzrahmen der 51 Produktions- und 14 Verwendungsverfahren (Spaltenstruktur) sowie 57 Produkte und 43 Vorleistungsgrößen (Zeilenstruktur) enthält. Diese detaillierte aktivitätsanalytische Unterteilung ermöglicht die Erfassung des gesamten Agrarsektors und die Identifikation von intra- und intersektoralen Stromgrößen und Verflechtungen.
Wie in Abbildung 1 dargestellt, wird die physische und monetäre Konsistenz der Daten durch ein System von Identitätsgleichungen überprüft. Hierbei wird für jedes Produkt und jede Vorleistung Aufkommen und Verwendung bilanziert. Ferner muß für jedes Verfahren die monetäre Summe der Vorleistungen, inklusive der Faktorentlohnungen, dem Produktionswert entsprechen. Wenn diese Identitätsgleichungen für jede Zeile und Spalte des Konsistenzrahmens erfüllt sind, ist der Wert der vier betrachteten Blöcke identisch und repräsentiert jeweils den Bruttoproduktionswert des Agrarsektors.
Die Abgrenzung des Agrarsektors erfolgt entsprechend der Definitionen zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR), wodurch die Nettoproduktion des Agrarsektors nach dem funktionalen Konzept ausgewiesen werden kann (Eurostat, 1989). Die Bruttoproduktion wird durch die Einbeziehung zusätzlicher intrasektoraler Verwendungskomponenten abgebildet und spiegelt den Gesamtwert der landwirtschaftlichen Produktion wieder. Die sektorale Wertschöpfung in Anlehnung an die Definitionen der LGR kann somit durch die Differenzierung der Verwendungsverfahren nach dem Produktbereichprinzip ausgewiesen werden. Hierdurch ist die Vergleichbarkeit zu den Gesamtrechnungsergebnissen der EU-Mitgliedsstaaten gegeben.
Abbildung 1: Identitätsgleichungen des Analyseansatzes
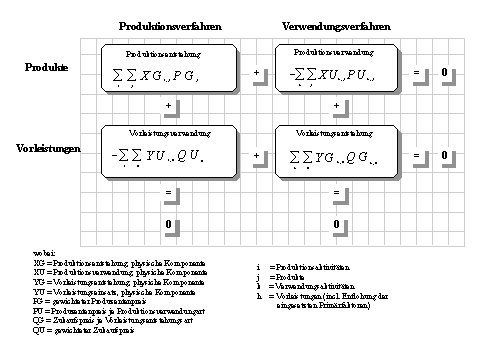
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an SPEL System (Wolf, 1995)
Da allgemein verfügbare Veröffentlichungen in einigen Bereichen wie Preisangaben und Vorleistungseinsatz nicht die erforderliche Datenqualität liefern können, sowie deren Aktualität oftmals wenig befriedigend ist, wird bei der Datenerhebung eine enge Zusammenarbeit mit den relevanten Institutionen in den MOEL angestrebt. Die Zusammenarbeit bei der Datenaufnahme ermöglicht außerdem eine Diskussion über die Ergebnisse der Analyse.
Mit der Umsetzung des prozeßanalytisch differenzierten Gesamtrechnungsansatzes für den ungarischen Agrarsektor wurden für die Jahre 1994 bis 1997 sektorale Wertschöpfungsergebnisse entsprechend der Definitionen der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung ausgewiesen. Die Erstellung der Datengrundlage und die Abstimmung der Gesamtrechnungsergebnisse wurde in enger Zusammenarbeit mit der LGR Arbeitsgruppe im Agrarökonomischen Institut in Budapest (AKII) und dem ASA-Institut für Sektoranalyse und Politikberatung GmbH, Bonn durchgeführt.
Die Berechnung der Einkommensindikatoren in Abbildung 2 erfolgte zu laufenden und konstanten Preisen (konstante Preise zu 1994 als schwarzer Teilbereich der Säulen). Zu laufenden Preisen weisen alle berechneten Einkommensindikatoren eine Steigerung innerhalb des betrachteten Zeitraums auf. Der Nettoproduktionswert (N-PROW) entsprechend der LGR stieg insgesamt von 1994 bis 1997 um ca. 80 %. Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (BWSM) als Differenz zwischen Produktionswert und Betriebsmitteleinsatz stieg im gleichen Zeitraum um 55 % an. Dieser geringere Anstieg der BWSM verdeutlicht, daß der Betriebsmitteleinsatz bewertet in laufenden Preisen ebenfalls deutlich gestiegen ist. Die in der betrachteten Periode kontinuierlich über 100 Mrd. Forint liegende Nettowertschöpfung zu Faktorkosten (NWSF) entspricht dem Betrag, der zur Entlohnung der eingesetzten Primärfaktoren Boden, Arbeit und Kapital verbleibt. Die Berechnungen zu konstanten Preisen haben gezeigt, daß den ausgewiesenen Wertsteigerungen lediglich geringe Mengenzuwächse zugrunde liegen. Insgesamt kann für die betrachtete Periode bei abnehmendem sektoralen Arbeitseinsatz und zunehmender NWSF von einer steigenden Produktivität in dem betrachteten Zeitraum ausgegangen werden.
Abbildung 2: Sektorale Wertschöpfungsrechnung in Mrd. Forint, Ungarn 1994 bis 1997
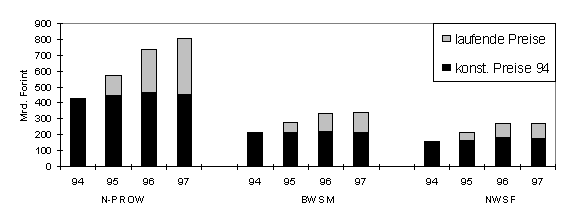
Die Differenzierung der Wertschöpfungsbeiträge in Tier- und Pflanzenproduktion zeigt eine wachsende Bedeutung der Pflanzenproduktion in Ungarn (vgl. Abbildung 3). Die deutliche Abnahme des Einkommensbeitrages durch die Tierproduktion im Jahre 1996 ist auf einem erheblichen Anstieg der pflanzlichen Produktpreise und gleichzeitig gestiegene Futterkosten zurückzuführen. Dieser Effekt wurde durch fallende Rindfleischpreise und anhaltend abnehmende Viehbestände unterstützt.
Abbildung 3: Anteile der Tier- und Pflanzenproduktion an der sektoralen Wertschöpfung
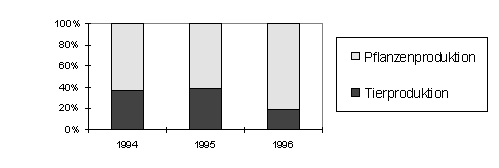
Quelle: Eigene Berechnungen
Die Unterteilung des Bruttoproduktionswertes und der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen in 9 Produktgruppen für das Jahr 1996 ermöglicht eine detaillierte Betrachtung der Pflanzenproduktion Ungarns (vgl. Abbildung 4). Die dargestellte Höhe des Produktionswertes (PROW) und der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (BWSM) für die Aktivitäten Mais-, Weizen-, Obst- und Gemüseanbau verdeutlicht deren hervorgehobenen Stellenwert für die Pflanzenproduktion und die gesamte Landwirtschaft Ungarns (vgl. Abbildung 3).
Abbildung 4: Wertschöpfung innerhalb der Pflanzenproduktion Ungarns in 1996
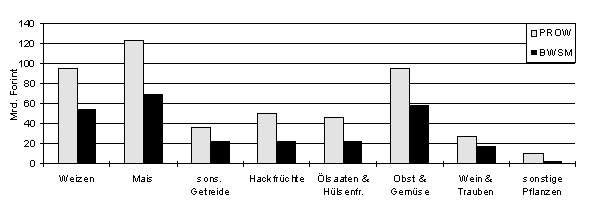
Zur Berechnung dieser Einkommensindikatoren je Produktionsverfahren werden zu jeder Aktivität Produktion und Vorleistungseinsatz erfaßt. Tabelle 1 zeigt am Beispiel der Weizenproduktion für die Jahre 1994 bis 1997 die vorgenommene Differenzierung. Diese Angaben der Tabelle sind als sektorale Durchschnittsgrößen pro ha aufgeführt und können über den Produktionsumfang als sektorale Größen, wie beispielsweise BWSM in Abbildung 4 ausgewiesen werden. Die in Tabelle 1 dargestellten Erträge (kg/ha) wurden als Durchschnittswert in Abhängigkeit von Gesamtaufkommen und Anbaufläche ermittelt. Das Gesamtaufkommen ist entsprechend der Identitätsgleichungen in Abbildung 1 zuvor mit dem Aggregat der Verwendungsbilanz gegenübergestellt worden. Diese Konsistenzüberprüfungen der Daten aus verschiedenen Quellen haben insbesondere bei Produkten wie Kartoffeln, Gemüse und Wein, von denen ein hoher Anteil in Hausgärten und Kleinbetrieben erzeugt wird, zur Aufdeckung von Inkonsistenzen in der Statistik geführt. Die physischen Produktionsdaten werden mit einem sektoralen Durchschnittspreis bewertet, der aus den Angaben der Preisstatistik zu den verschiedenen Verwendungsarten als gewichteter Durchschnitt ermittelt wird.
Tabelle 1: Produktionsverfahren Weizen im Sektordurchschnitt 1994 bis 1997
|
Jahr |
1994 |
1995 |
1996 |
1997* |
||||||
|
physisch |
monetär |
physisch |
monetär |
physisch |
monetär |
physisch |
monetär |
|||
|
Winterweizenertrag dt / ha |
45,8 |
41,6 |
32,7 |
41,1 |
||||||
|
sektoraler Durchschnittspreis FT / t |
9.577 |
10.984 |
24.358 |
19.700 |
||||||
|
Bruttoproduktionswert FT / ha |
43.863 |
45.693 |
79.651 |
80.967 |
||||||
|
N Mineraldünger kgRN/ha u. FT/ha |
114 |
3.895 |
104 |
4.960 |
94 |
6.115 |
||||
|
P Mineraldünger kgRN/ha u. FT/ha |
14 |
721 |
13 |
1.005 |
13 |
1.379 |
||||
|
K Mineraldünger kgRN/ha u. FT/ha |
15 |
515 |
10 |
573 |
10 |
784 |
||||
|
Saatguteinsatz FT / ha |
2.417 |
3.209 |
4.035 |
|||||||
|
Pflanzenschutzmittel FT / ha |
2.209 |
3.119 |
5.104 |
|||||||
|
sonstige Vorleistungen FT / ha (Reparatur, Energie und sonst. Vorl.) |
9.201 |
14.123 |
20.815 |
|||||||
|
BWS zu Marktpreisen FT / ha |
24.905 |
18.705 |
41.419 |
|||||||
|
* vorläufige Information |
||||||||||
Quelle: Eigene Berechnungen in Zusammenarbeit mit AKII
Neben den Outputkoeffizienten sind in Tabelle 1 Inputkoeffizienten pro ha abgebildet, die aus einzelbetrieblichen Erhebungen stammen und wesentlich zur Überprüfung der sektoralen Vorleistungsdaten beitragen. Hierbei wird ein theoretischer sektoraler Vorleistungseinsatz (z. B. Einsatz an Stickstoffmineraldünger) anhand der Multiplikation von Koeffizienten und Produktionsfläche über alle Anbauverfahren errechnet. Der Vergleich dieser Größe mit der sektoralen Originalzahl (z.B. Düngermittelhandelsstatistik) bringt teilweise erhebliche Unterschiede hervor. Zur Erfüllung der Identitätsgleichungen (vgl. Abbildung 1) werden beim Vorliegen dieser Abweichungen die Koeffizienten im Block der Vorleistungsverwendung entsprechend der Originalzahl aus der Statistik, die im Block der Vorleistungsentstehung abgebildet ist, angepaßt. Beim mineralischen Dünger hat sich dabei beispielsweise gezeigt, daß der Aufwand an Phosphor und Kali in den letzten Jahren im sektoralen Durchschnitt erheblich unter den Angaben der Testbetriebsstatistik und dem Niveau der früheren Jahre gelegen haben muß, was zu einer Verringerung dieser Inputputkoeffizienten auf das in Tabelle 1 ausgewiesene Niveau im Analyseansatz geführt hat. Für den Einsatz von Stickstoffmineraldünger konnte dagegen bei diesen Plausibilitätsüberprüfungen ermittelt werden, daß der durchschnittliche Einsatz auf der Höhe der Vorleistungskoeffizienten liegt, was gleichzeitig dem Stickstoffentzug in dem betrachteten Zeitraum entspricht.
Für den Bereich der Pflanzenproduktion bleibt abschließend festzuhalten, daß die durchweg positiven Wertschöpfungsbeiträge, insbesondere der dominierenden Produktionsverfahren wie Weizen und Mais, unter dem Aspekt des geringen Vorleistungseinsatzes zu relativieren sind. Aus dem weitestgehenden Verzicht auf Erhaltungsdüngung (Phosphor und Kali) in den letzten Jahren kann geschlossen werden, daß die Bodenreserven zunehmend aufgebraucht wurden. Um das aktuelle Ertragsniveau halten zu können, sind daher schon kurzfristig erhöhte Aufwendungen in diesem Bereich zu tätigen. Für eine Rückkehr zu Outputniveaus der achtziger Jahre, die generell über den Erträgen der letzten Jahre lagen, sind dementsprechend überproportionale Mehraufwendungen notwendig. Ob hierzu die oben skizzierten Wertschöpfungsbeiträge in der absoluten Höhe ausreichen ist fraglich.
Prinzipiell erfolgt die Abbildung der Tierproduktion im Analyseansatz analog zur Pflanzenproduktion. Die Berücksichtigung von zeitabhängigen Bestandsentwicklungen und die Aufteilung des sektoralen Futterangebotes auf die einzelnen Tierhaltungsaktivitäten erfordern allerdings spezielle Vorgehensweisen.
Abbildung 5: Nettoproduktionswerte ungarischer Tierhaltungsverfahren von 1994 -1996
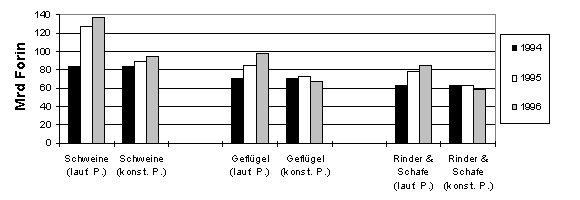
In Abbildung 5 ist eine Steigerung des Nettoproduktionswertes aus der Schweinehaltung von 80 auf 135 Mrd. Forint zu erkennen, die einen erheblichen Anstieg der marktfähigen Endproduktion in laufenden Preisen verdeutlicht. Der Anstieg für die Bereiche Geflügel-, Rinder- und Schafhaltung fällt deutlich geringer aus. Bewertet zu konstanten Preisen 1994 zeigt sich bei Schweinen ebenfalls ein Anstieg wogegen die Rindviehhaltung negative Tendenzen aufweist.
Die Darstellung der Tierproduktion im Analyseansatz erfordert die Unterteilung in verschiedene Zucht- und Mastverfahren, die hinsichtlich Altersstufen und Geschlechterverteilung spezifiziert sind. Die Umfänge dieser Verfahren werden anhand von Bestands- und Schlachtstatistiken als Stromgrößen ermittelt. In der ungarischen Rindviehhaltung kann ein hoher Anteil der Milchkühe am Gesamtbestand (laut Statistik) beobachtet werden. Die darauf aufbauende modellendogene Differenzierung (vgl. Abbildung 6) ergab mit 0,6 aufzuchtfähigen Kälbern pro Kuh einen unrealistisch geringen Wert. Die Rücksprache mit ungarischen Experten hat bestätigt, daß ein nicht unerheblicher Teil der Kälber direkt nach der Geburt getötet wird und somit in keiner Statistik erscheint. Hierdurch kann unterstellt werden, daß tatsächlich eine wesentlich höhere Abkalbequote vorliegt. Diese statistisch nicht abgesicherte Annahme wird durch die beobachtete steigende durchschnittliche Milchleistung von über 4000 l pro Kuh im beobachteten Zeitraum unterstützt.
Abbildung 6: Bestandsentwicklung in der ungarischen Rindviehhaltung in 1000 Stück
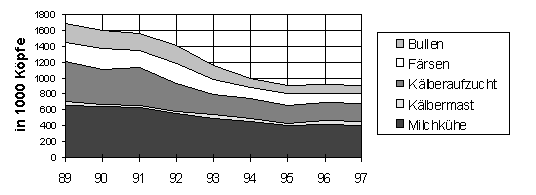
Quelle: Eigene Berechnungen auf der Basis von Daten der ungarischen Statistik und der FAO
Die Untersuchungen haben gezeigt, daß die miserablen Erlöse für Rindfleisch in den letzten Jahren offenbar zu einer weitgehenden Konzentration auf die Milchproduktion innerhalb der ungarischen Rindviehhaltung geführt haben. Bei gleichbleibenden Bedingungen ist eine Trendwende in der Bestandsentwicklung nicht zu erwarten, sondern eher ein weiterer Bestandsabbau, da die Rindfleischproduktion zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinerlei Gewinne zuläßt. Innerhalb der ungarischen Tierproduktion liefern Schweine- und Geflügelhaltung die wesentlichen Einkommensbeiträge. Dennoch zeigen aktuelle Zahlen für 1997 einen Bestandsabbau in der Schweinehaltung, der unter anderem auf stark schwankende Schweinefleischpreise zurückzuführen ist.
Die bisherigen Erfahrungen bei der Umsetzung des Sektoralen Basismodells haben gezeigt, daß die Anwendung des Analyseansatzes insbesondere in folgenden Bereichen Vorteile bietet:
Weder die alleinige Orientierung am Produktionspotential vergangener Jahre noch die Unterstellung westeuropäischer Produktionsparameter scheinen geeignet, die zu erwartende Agrarproduktion der MOEL für die nächsten Jahre zu prognostizieren. Am Beispiel Ungarn wurde dargestellt, daß positive Einkommensbeiträge einzelner Produktionsbereiche nicht direkt mit Produktionssteigerungen in der Folgeperiode korrespondieren müssen. Wie in der Tierhaltung (siehe Kap. 3.3) wird auch die zukünftige Entwicklung im Pflanzenbau durch die Produktionsweise (siehe Kap. 3.2) der vergangenen Jahre wesentlich beeinflußt. Inwieweit diese Einflüsse ausgeglichen werden können, hängt von zukünftigen Rahmenbedingungen ab.
Vor diesem Hintergrund wird für die quantitative Prognose ein auf dem sektoralen Basismodell aufbauendes Konsistenzrahmenmodell angewendet, um partielle Analysergebnisse, endogene Modellparameter und Expertenwissen unter Berücksichtigung agrasektoraler Faktorkapazitäten und Verflechtungen zu integrieren. Hiermit können Auswirkungen verschiedener Rahmenbedingungen auf Produktion und Einkommen des Agrarsektors abgebildet werden.
Summary
For CEEC-Agriculture a dramatic change in agricultural production can be observed for the last decade as well as a changed role of statistical institutions. An important result of the activity based approach used to establish an information system are income indicators for the agricultural sector. These indicators are calculated and analysed for each of 51 production activities. Results for Hungary for the years 1994 to 1997 are discussed in detail. Also the emphasis is placed on consistency checks within the activity based approach that are applied collecting and processing necessary data.
Literaturverzeichnis
Cypris, C., Kreins, P. (1997): Das Agrar- und Umweltinformationssystem RAUMIS - Ein Prototyp für Analysen des Transformationsprozesses in den MOE-Ländern? Beitrag zur 38. Jahrestagung der Gewisola, Freising-Weihenstephan.
Eurostat (1989): Handbuch zur Landwirtschaftlichen und Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung, Luxembourg: Eurostat.
Henrichsmeyer, W., Cypris, Ch., Löhe, W., Meudt, M. (1996): Entwicklung des gesamtdeutschen Agrarsektormodells RAUMIS96 am Lehrstuhl für Agrarpolitik, Volkswirtschaftslehre und landwirtschaftliches Informationswesen der Universität Bonn. In: Agrarwirtschaft 45, Seite 213 - 215.
Henrichsmeyer, W., Gregor, G., Schmitz, H., Cypris, Ch., Sindern, D., löhe, W., Neumetzler, H., Angermüller, H., Wettstädt, G. (1993): Entwicklung eines differenzierten Simulations- und Monitoringsystems für den Agrarbereich der ehemaligen DDR (SIMONA), Forschungsbericht zur zweiten Projektphase (BML 90 HS 021), unveröffentlicht, Bonn.
Wolf, W. (1995): SPEL System: Methodological Documentation (Rev. 1), Vol.1:Basics, BS, SFSS. Theme 5 Series E, Luxembourg: Eurostat.
Az utolsó módosítás: 2005.05.29.
© miau