<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS>
<IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK>
<NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK>

| Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 1 | HU ISSN 1419-1652 |
<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS> <IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK> <NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK> |  |
Aufbau eines Politikinformations-Systems für die Agrarsektoren der Transformationsländer (PIT) Referent: Dipl.-Ing. Agr. Jochen Köckler
Institut für Agrarpolitik, Marktforschung und Wirtschaftssoziologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Nußallee 21,
D-53115 Bonn
homepage: hppt://www.agp.uni-bonn.de
e-mail: koeckler@agp.uni-bonn.de
Sehr geehrte Damen und Herren das Thema des Vortrages lautet: "Aufbau eines Politikinformations-Systems (PIT) für die Agrarsektoren der Transformationsländer." Zunächst kurz zu meiner Vorstellung, mein Name ist Jochen Köckler und ich bin am Institut für Agrarpolitik in Bonn als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Herrn Prof. Henrichsmeyer beschäftigt.
Die laufenden Arbeiten erfolgen innerhalb des FAIR-Projektes "Agricultural Implications of the CEEC Accession to the EU", einem Gemeinschaftsprojekt von vier Universitäten, wobei es die Aufgabe der Bonner Forschergruppe ist, eine konsistente ländervergleichbare Datenbasis für die jeweiligen Agrarsektoren bestimmter MOEL zu erstellen.
Das Referat ist wie folgt aufgebaut:
- Nach der Skizzierung der Problemstellung wird zunächst ein kurzer Überblick zu den bestehenden Modellen am Institut für Agrarpolitik gegeben. Hierbei soll gezeigt werden, in welcher Weise die Wissenschaft ihren Beitrag zur Informationsbereitstellung und Politikberatung leisten kann.
- Hiernach werden Ziele, Konzept und Methodik des angestrebten Informations-System für Ungarn vorgestellt.
- Im weiteren werden anhand von ersten empirischen Ergebnissen zur Ex-post Analyse Beispiele für die Umsetzung am ungarischen Agrarsektor gegeben.
- Abschießend werden die bisherigen Erfahrungen bei der Umsetzung geschildert und ein kurzer Ausblick für die Zukunft gegeben.
Wegen der nur sehr begrenzt zur Verfügung stehenden Zeit werden die einzelnen Punkte teilweise nur benannt und kurz erläutert. Ich würde mich freuen, wenn die für Sie besonders interessanten Bereiche in der anschließenden Diskussion oder später per e-mail (oder über andere Kommunikationsmöglichkeiten) vertieft werden könnten.
Als Hintergrund für den Aufbau eines Informationssystems läßt sich folgende Problemstellung skizzieren:
1. Seit Beginn des Transformationsprozesses unterliegen die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen in den MOE-Staaten auf dem Weg von der zentralistischen Planwirtschaft zu mehr marktwirtschaftlich ausgeprägten Wirtschaftssystemen weitreichenden Veränderungen.
2. Diese Veränderungen haben auch in den Agrarsektoren erhebliche Anpassungsreaktionen hervorgerufen. (Als Beispiel seien hier nur die stark abnehmende Viehbestände in fast allen MOEL genannt)
3. Zeitgleich erfolgten zahlreiche Umstellungen in der statistischen Erfassung durch personelle und institutionelle Änderungen.
4. Ferner ist der angestrebte EU-Beitritt der Mittel- und Osteuropäischen Länder zu berücksichtigen.
Die zu beobachteten hier skizzierten Veränderungen erschweren die Erstellung von Zeitreihen zur Beschreibung der Lage der Landwirtschaft. Der anvisierte EU-Beitritt verstärkt zudem den Bedarf an länderübergreifenden und EU-vergleichbaren Sektordaten. Zur Bereitstellung dieser Informationen soll die Anwendung des hier vorzustellenden differenzierten Analyseansatzes einen Beitrag leisten.
Bevor aber nun das angestrebte Politikinformationssystem mit dem entsprechenden Analyseansatz vorgestellt wird, soll zunächst ein kurzer Überblick zu den bestehenden Modellen am Institut für Agrarpolitik (IAP) gegeben werden.
Die Entwicklung des Informations-System PIT sieht vor, wie sie im zweiten Teil des Vortrages hören werden, nach den entsprechenden Entwicklungsschritten in einem Agrarsektormodell zu münden. Deshalb möchte ich zunächst den Begriff definieren, um anschließend Anlaß bzw. Notwendigkeit zur Erstellung eines solchen umfassenden Systems zu diskutieren.
Ein Agrarsektormodell ist nach A.Burell als ein abstrakter, quantifizierter Rahmen für die geordnete Darstellung unterschiedlicher Informationen über Struktur und Funktionsweise des Agrarsektors. Zur Konzeption dieses Rahmens gehört eine theoretische Vorstellung davon, wodurch die Ereignisse im Agrarsektor bestimmt werden, d.h. eine Vorstellung von den ursächlichen Verknüpfungen und Verhaltensweisen innerhalb des Agrarsektors. Diese theoretische Vorstellung sollte mit den verfügbaren empirischen Informationen übereinstimmen und sie erläutern. Ein empirisches Sektormodell integriert diese Informationen in Form numerischer Parameter und überträgt häufig ihre Struktur auf die Datenbank, die zur Ermittlung der Parameter verwendet wird. Ein solches Modell fungiert als Speicher, in dem frühere Erfahrungen über die Leistungen des Sektors in Form von Wissen über die den Sektor steuernden ursächlichen Zusammenhänge und ihre Ergebnisse abgelegt sind.
In der aufliegenden Folie wird zunächst einmal die Frage nach den Gründen für die Entwicklung eines Sektormodells gestellt? Warum Agrarsektormodelle ?
Nach Henrichsmeyer ist ein Agrarsektormodell potentiell ein nützliches Instrument für die politischen Entscheidungsträger, indem frühere Erfahrungen in systematischer und zugänglicher Weise geordnet werden.
Ein solches Modell zur Verbesserung der Entscheidungsfindung ist in drei Hauptanliegen begründet:
- den Wunsch die Zukunft zu kennen
- das Bestreben die Folgen einer Entscheidung durchzuspielen, bevor sie in die Praxis umgesetzt wird
- und die Notwendigkeit die Effizienz von Entscheidungen zu beurteilen nachdem sie umgesetzt sind
Ein Sektormodell wird diesen Anliegen durch die Erstellung von Vorausschätzungen und der Simulation politischer Maßnahmen gerecht. Hierbei ist das Modell um so nützlicher für den politischen Verantwortlichen, je größer seine Fähigkeit ist, Neuigkeiten für den Entscheidungsträger zu generieren, und insbesondere, die sensiblen und heiklen Bereiche der Politik zu beleuchten, wo in sozialer und politischer Hinsicht am meisten auf dem Spiel steht.
Als Ausgangsbasis und Datengrundlage für die Entwicklung von Agrarsektormodellen können grundsätzlich sektorale Daten, wie aus der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR) oder einzelbetriebliche Daten aus Testbetriebsstatistiken genutzt werden. Die bisherigen Erfahrungen am Institut haben jedoch gezeigt, daß in der Regel die Repräsentanz der Testbetriebe nicht ausreicht, um hieraus sektorale Aussagen abzuleiten. Zunächst wurden diese verschiedenen Ansätze lediglich ergänzend nebeneinander eingesetzt, aber nicht in einem Ansatz verbunden. In den letzten Jahren wird jedoch eine direkte Verbindung dieser Datenquellen in einem System angestrebt.
Im weiteren werden nun kurz, ohne Anspruch auf Vollständigkeit die Modelle vorgestellt, die unter der wissenschaftlichen Verantwortung von Herrn Prof. Henrichsmeyer am IAP entwickelt worden sind.
Das Modell DIES (Dispositives Informationssystem für das Einkommen im Agrarsektor) ist ein Betriebsgruppenmodell. Im weiteren werden Ziele, Aufgaben, konzeptionener Aufbau und Implementierung kurz skizziert:
Ziele und Aufgaben:
Implementierung und Anwendung
Zur Umsetzung der oben genannten Ziele wird das System im Bundesministerium für Landwirtschaft in Bonn (BML) seit Beginn der achtziger Jahre angewendet. Hierbei steht die Analyse der Auswirkungen alternativer agrarpolitischer Maßnahmen auf die verschiedenen Betriebsgruppen im Vordergrund.
Das Raumis Modelling System ist ein Politikinformatinssystem auf der Basis von 431 Kreisen für Deutschland (NUTS 3), das im Auftrag des BML in Bonn erstellt wurde.
Die Hauptaufgaben sind die Beschreibung und Analyse der Beziehungen zwischen der Landwirtschaft und Umwelt sowie mittelfristige Simulationen verschiedener Szenarien zu Agrar- und Umweltpolitik.
Charakteristika von RAUMIS:
RAUMIS ist seit 1993 im BML implementiert und wird dort für Simulationsrechnungen genutzt.
Die Entwicklung des SPEL-Systems begann Anfang der 80er Jahre auf Anregung von Eurostat in Luxemburg. Der Auftrag bezog sich zunächst darauf, ein Sektorales Produktions- und Einkommensmodell für die Landwirtschaft zu entwickeln, das es ermöglichte:
Bei der Entwicklung ging es nicht um die Erstellung eines Agrarsektormodells für ausschließlich akademische Zwecke, sondern beinhaltete vielmehr die Entwicklung eines Politikinformations-Systems, das sowohl ein integriertes Datenhaltungssystem, wie verschiedene Versionen politikbezogener Vorausschätzungs- und Simulationsmodelle umfaßt.
Diese drei Komponenten werden an dieser Stelle nur benannt und können wegen der Kürze der Zeit nicht genauer vorgestellt werden:
Das SPEL System umfaßt heute die 15 Mitgliedsstaaten und wird zum einen am IAP durch ein Forscherteam ständig weiterentwickelt und zum anderen ist es bei Eurostat in Luxemburg implementiert, wo es als Informations-Sytem für die entsprechenden Analysen angewendet wird. Eingehende Analysen wurden u.a. zu den folgenden Fragenkomplexen erarbeitet:
1985 Grünbuch der EG-Kommission
1988 Abbau von Währungsausgleichsbeträgen
1990 Abbau der Preisstützung im Rahmen der GATT-Diskussion
1991 EG-Kommissionsvorschlag zur GAP-Reform (Mc Sherry Vorschlag)
1992 Ministerratsbeschluß zur GAP Reform
Das Modell WATSIM (World Agriculture Trade Simulation Model) wurde Ende der 80er Jahre im Auftrag der EU-Komission entwickelt. Anlaß war der Bedarf nach einem Werkzeug, das die Analyse des Einflusses agrarpolitischer Instrumente, insbesondere in Verbindung mit der Uruguay-Runde der GATT-Verhandlungen, auf den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten in den Regionen der Erde ermöglicht. Methodisch kann es als komparativ-statisches, nicht räumliches Modell charakterisiert werden, das die wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte abdeckt und die Welt in 24 Regionen abbildet.
Abschließend bleibt festzuhalten, daß gerade die Erfahrungen aus den Modellen RAUMIS und SPEL beim Aufbau eines Politik-Informations-Systems für die Transformatinosländer genutzt werden könnten, um zunächst eine geschlossene Abbildung des Agrarsektors und die Vergleichbarkeit zu den sektoralen Größen der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung zu erreichen.
Ferner zeigt die Anwendung aller Modelle in den verschiedenen Institutionen auf deutscher und europäischer Ebene, als Instrument zur politiknahen Beratung, daß wissenschaftliche Institute mit der Entwicklung solcher Systeme offenbar einen Beitrag zur Entscheidungsunterstüzung leisten können.
Nach dem Exkurs über bestehende Informationssysteme und deren Einsatzgebiete möchte ich nun wieder konkret zum PIT-System zurückkehren. Die Ziele des Informationssystems lassen sich wie auf der Folie dargestellt in drei Punkten zusammenfassen:
1. Geschlossene Abbildung der Produktionsstruktur des Agrarsektors
2. Diagnose und Ex-post Analyse von Produktions-, Produktivitäts-, Preis- und Einkommensentwicklungen.
3. Prognose und Simulationen
Diese Ziele sollen schrittweise mit der Umsetzung der in Abbildung 1 angegebenen Module erreicht werden.
Abbildung 1: Aufbau von PIT
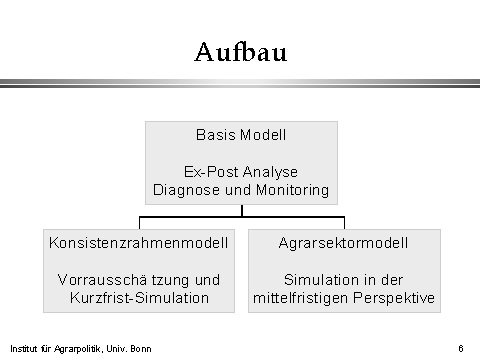
Quelle: Eigene Beschreibung
Im Basis Modell werden die Daten aus vielfältigen Quellen im Rahmen des aktivitätsanalytisch differenzierten Gesamtrechnungsansatzes zusammengeführt. Als Datenquellen sind hierbei folgende Größen zu unterscheiden:
- orginärestatistische Daten, die aus amtlichen Statistiken stammen
- semi-orginäre statistische Daten, die aus offiziellen statistischen Daten abgeleitet sind
- Kalkulationsdaten, die auf einzelbetrieblichen Erhebungen und produktionstechnischen Kennzahlen basieren
- Residualgrößen, die sich aus den Definitionsgleichungen geschlossener Kreislaufzusammenhänge ableiten lassen und häufig bestimmte Plausibilitätsprüfungen anhand ähnlicher statistisch ausgewiesener Größen ermöglichen
- Experteneinschätzungen als vorläufige Größe bei fehlenden Datenangaben
Zu dieser Datensammlung wurde ein Aufnahmemodul geschaffen, in das diese Informationen aus den verschiedenen Quellen flexibel importiert werden können. Entweder können die Daten manuell in anwenderfreundliche Oberflächen eingegeben werden oder sie werden über Importroutinen aus anderer Software in das Basis Modell importiert. Die weiteren Schritte der Datenverarbeitung werden im nächsten Abschnitt zur Methodik erläutert.
Nachdem die Daten aufgenommen worden sind und in die entsprechende Struktur überführt wurden, kann eine geschlossene Ex-post Abbildung der landwirtschaftlichen Produktionsstrukturen sowie der intra- und intersektoralen Input und Outputverflechtungen vorgenommen werden.
Basierend auf der differenzierten Information des Basis Modells werden in den Teilbereichen 2. und 3. Prognose und Simulationen durchgeführt. Das Konsistenzrahmenmodell dient dazu, Indikatoren, Experteneinschätzungen, Ergebnisse partieller Analysen und endogene Anpassungsreaktionen im Konsistenzrahmen von PIT zusammenzuführen, um mit diesen Parametern die Auswirkungen verschiedener Rahmenbedingungen auf die Produktion und das Einkommen des Agrarsektors zu zeigen (Monitoring und Wirkungsanalyse). Neben der modellendogenen Abbildung der Viehbestände und des Futterkomplexes erfordert die Anwendung des KRM zahlreiche Vorwegspezifizierungen exogener Parameter.
Im Agrarsektormodell werden diese exogenen Parameter durch endogene Substitutionsbeziehungen zwischen Produktion und Faktoreinsatz ersetzt, wenn hierzu ausreichend abgesicherte Erkenntnisse vorliegen. Die Umsetzung dieser Komponente ist als Lineares Optimierungsmodell mit "Verhaltensrestriktionen" bzw. Nichtlineares Optimierungssmodell unter Anwendung der "Positiven Mathematischen Programmierung" vorgesehen.
Zum momentanen Bearbeitungszeitpunkt ist das Basismodell für die Jahre 1994 bis 1996 realisiert.
Der methodische Hintergrund von PIT ist im wesentlichen durch den prozeßanalytisch differenzierten Gesamtrechnungsansatz charakterisiert. Dieses Ansatz bildete für die Entwicklung von SPEL ebenfalls die Grundlage und stellt ein wesentliches Charakteristikum dieses Systems da. Diese Tatsache stellt sicher, daß die ausgewiesenen Ergebnisse vergleichbar zu den Angaben des SPEL-systems sind und daher zusätzliche Analysemöglichkeiten mit der EU Landwirtschaft bietet.
Die Erfassung dieses Bruttoproduktionswertes erfolgt mit Hilfe einer tief gegliederten prozeßanalytischen Untersetzung. Mit diesem Analyseansatz wird der Agrarsektor in verschiedene Produktions- und Verwendungsaktivitäten differenziert. Grundlage dieser Abbildung ist ein tabellarisch aufgebauter Konsistenzrahmen, der 51 Produktions- und 14 Verwendungsverfahren (Spaltenstruktur) sowie 57 Produkte und 43 Vorleistungsgrößen (Zeilenstruktur) enthält.
Für jede Produktionsaktivität werden Outputs und Inputs erfaßt. Der Output ist beispielsweise bei der Aktivität Milchkuhhaltung die produzierte Milch, das produzierte Rindfleisch druch die geschlachteten Kühe und die angefallenen Kälber. Als Inputs werden in dieser Aktivität neben anderen Vorleistungen beispielsweise Futter und Pharmazie betrachtet.
In den Verwendungsaktivitäten werden die bereichsinterne Verwendung (z.B. Grundfutter) und die Verflechtungen mit anderen Sektoren abgebildet (z.B. Verkauf von Marktprodukten und Zukauf von Vorleitungen). Diese Unterteilung der Verwendungsaktivitäten ermöglicht auch die Berechnung der Nettoproduktion entsprechend des Produktbereichsprinzips der Definitionen zur LGR. Im wesentlichen sind dies die Verflechtungen mit anderen Sektoren.
Die physische und monetäre Konsistenz der Daten wird durch ein System von Identitätsgleichungen überprüft. Hierbei wird für jedes Produkt und jede Vorleistung Aufkommen und Verwendung bilanziert. Ferner muß für jedes Verfahren die monetäre Summe der Vorleistungen, inklusive der Faktorentlohnungen, dem Produktionswert entsprechen. Wenn diese Identitätsgleichungen für jede Zeile und Spalte des Konsistenzrahmens erfüllt sind, ist der Wert der vier betrachteten Blöcke identisch und repräsentiert jeweils den Bruttoproduktionswert des Agrarsektors.
Zu der Methodik der Vorausschätzungs- und Simulationsmodule möchte ich an dieser Stelle nur einige Ideen vorstellen, da diese noch nicht umgesetzt sind und sich im Zeitablauf der Entwicklung an den besonderen Bedingungen in den Transforamtionsländern orientieren sollten.
Für das Konsistenzrahmenmodell ist angestrebt, auf der Basis der aktuellsten verfügbaren Produktionsstruktur endogene Mechanismen zur Futterverteilung und Bestandsfortschreibung, sowie exogen gesetzte Parameter zur Abbildung der Wirkungszusammenhänge in einem geschlossenen Ansatz zu integrieren. Diese Vorausschätzung könnte bei stabilerer Entwicklung durch ökonometrische und trendorientierte Vorausschätzung erweitert werden. In einer ersten Phase wird dieser Ansatz durch die systematische Einbeziehung von Expertenwissen und anderen Vorabinformationen zur zukünftigen Entwicklungen geprägt sein.
Im Agrarsektormodell wird dann angestrebt schrittweise die Anpassungen endogen abzubilden, wie z.B. die Substitution des Faktoreinsatzes. Die Simulationen werden dann in einem linearen oder nicht-lineares Programmierungsmodell durchgeführt. Bei dem NLP-Ansatz wird angestrebt mit der positiven mathematischen Programmierung zu arbeiten.
Im zweiten Teil des Vortrages werden die Umsetzung des Analyseansatzes für den Ungarischen Agrarsektor und die daraus resultierenden Ergebnisse dargestellt. Diese sind in Zusammenarbeit mit der LGR-Arbeitsgruppe im Agrarökonomischen Institut in Budapest, dem Lehrstuhl für Agrarinformatik an der Universität Gödöllö und dem ASA Institut (Bonn) entstanden.
Die empirischen Ergebnisse entsprechen dem Stand der Bearbeitung im Oktober 1997 und sind in ihrem Zustandekommen noch nicht endgültig mit den Datenlieferanten diskutiert, so daß als vorläufig angesehen werden müssen.
In der vorliegenden Folie wird die sektorale Wertschöpfungsrechnung für den ungarischen Agrarsektor zu laufenden Preisen (gesamte Höhe der Säulen) und zu konstanten Preisen von 1994 (unterer dunklerer Teil der Säulen) abgebildet.
Abbildung 2: sektorale Wertschöpfungsrechnung des ungrischen Agrarsektors nach dem funktionalen Konzept der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung
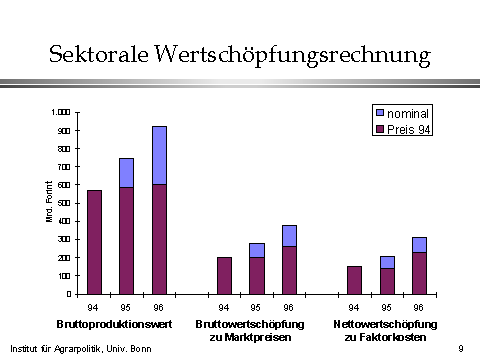
Quelle: Eigene Darstellung
Der Bruttoproduktionswert zu laufenden Preisen ist von 94 nach 95 um 31 % von 95 nach 96 um 23 %. gestiegen. Nach Abzug aller fixen und variablen Vorleistungen erhält man die Buttowertschöpfung zu Marktpreisen zu den drei betrachteten Jahren die von 94 bis 96 ebenfalls eine steigende Tendenz aufweisen.
Nach Abzug der Abschreibungen und Saldierung um die Steuern und Subventionen erhält man die Nettowertschöpfung zu Faktorkosten. Dieser Betrag verbleibt um die Primärfaktoren Arbeit, Boden und Kapital zu entlohnen (Anstieg von 94 nach 95 35 %, Anstieg von 95 nach 96 um 50 %). Die beiden Einkommensgrößen BWSM und NWSF sind vergleichbar zu den Größen der LGR in den EU-Mitgliedsstaaten.
Zu konstanten Preisen 1994 stellt sich allerdings ein deutlich differenzierteres Bild dar. Der Bruttoproduktionswert weist einen erheblich niedrigeren Anstieg auf. Die BWSM ist in den Jahren 94 und 95 annähernd gleich, wogegen sie im Jahre 96 um 13 % ansteigt. Hieraus folgt, daß im Jahre 96 für eine vergleichbare Produktion weniger Vorleistungen eingesetzt wurden. Dadurch verblieb für die Entlohnung der Primärfaktoren im Jahre 96 somit auch zu konstanten Preisen bewertet ein höherer Betrag.
Nachdem diese Wertschöpfungsrechnung die gesamtsektorale Entwicklung darstellt, soll nun für den Teilbereich der Weizenproduktion die Informationsgewinnung und ein beispielhaftes Analyseergebnis im Detail dargestellt werden.
In dieser Folie wird der Bruttoproduktionswert und der Beitrag der Weizenproduktion zur Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen für die Jahre 94 bis 96 dargestellt.
Abbildung 3: Wertschöpfungsrechnung der ungarischen Weizenproduktion
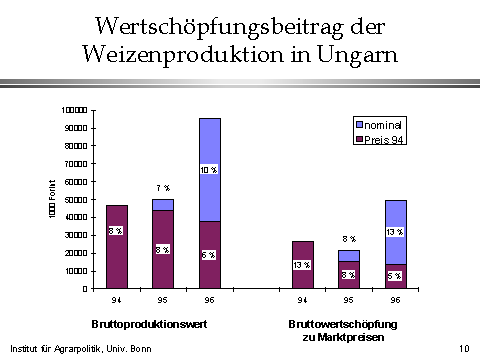
Quelle: Eigene Darstellung
Der Anteil der Weizenproduktion am Gesamtproduktionswert hat sich in dem betrachteten Zeitraum von 8 % auf 10 % erhöht, wobei die absolute Höhe von ca 45 Mrd. Forint auf 96 Mrd. Forint gestiegen ist. Zu konstanten Preisen von 94 stellt sich das Bild allerdings umgekehrt da. Die absolute Höhe und der Anteil an der Bruttoproduktion nehmen ab, da in 96 der sektorale Durchschnittspreis deutlich über dem von 94 lag und eine geringere Gesamtmenge zu beobachten ist.
Die Betrachtung der BWSM in 1996 zeigt, daß für Weizen der Produktionswert weitaus stärker gestiegen ist als der bewertete Betriebsmitteleinsatz.
Für eine tiefergehende Analyse der beobachteten Entwicklungen ist es sinnvoll Output und Input in einem sektoralen Durchschnittsverfahren zu betrachten. (Angaben pro ha)
Die Folie zeigt das Produktionsverfahren Winterweizen im Sektordurchschnitt mit Output- und Inputkoeffizienten pro ha.
Abbildung 4: Weizenproduktion im Sektordurchschitt
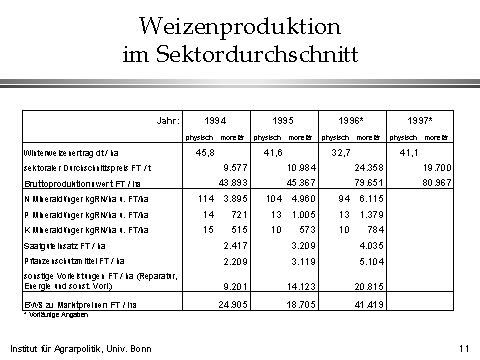
Quelle. Eigene Darstellung
Die Outputkoeffizienten, in diesem Falle der Weizenertrag sind abgeleitet aus produzierter Gesamtmenge und Anbauumfang. Bei Multiplikation mit dem sektoralen Druchschnittspreis läßt sich daraus der Bruttoproduktionswert pro ha ermitteln.
Die Inputs zu den jeweiligen Verfahren sind nicht als Totalerhebung in der Statistik zu finden, so daß zu den jeweiligen Inputgrößen für die einzelnen Verfahren Angaben der Testbetriebsstatistik genutzt werden (in Ungarn zu meldpflichtigen Betrieben).
Die Angaben der einzelbetrieblichen Statistik zum Düngereinsatz werden über alle Verfahren zu einem "theoretischen Vorleistungseinsatz" der gesamten Landwirtschaft hochgerechnet und den Angaben aus der Handelsstatistik gegenübergestellt. Abweichungen führen zu einem Dialog mit den Datenlieferanten und meist zu einer Kalibrieung der einzelbetrieblichen Daten.
Bei der Betrachtung der Ergebnisse zeigt sich für Phosphor und Kali, dessen Einsatzkoeffizienten im Rahmen der Kalibrierung reduziert wurden, daß die Ausbringungsmenge weit unter dem Entzug liegt. Diese Tatsache verdeutlicht wie aus der Kombination von einzelbetrieblichen Daten und sektoralen Daten ein Beitrag zur Informationsgewinnung resultiert.
Weiterhin wird gezeigt, daß im abgebildeten Zeitraum die Bodenreserven offenbar aufgebraucht wurden. Dieser Sachverhalt sollte für eine Abschätzung zukünftiger Angebotsentwicklungen unbedingt berücksichtigt werden.
Nach der intensiven Betrachtung des Winterweizens soll nun ein Beispiel der Abbildung der Tierproduktion im Analyseansatz erläutert werden. Prinzipiell findet die Abbildung analog zur Pflanzenproduktion statt, weshalb hier nur einige besondere Aspekte am Beispiel der Rindviehproduktion angesprochen werden:
Die Folie zeigt die Entwicklung des Geamtrindviehbestandes von 1989 bis 1997.
Abbildung 5: Bestandsentwicklung der ungarischen Rindviehhaltung
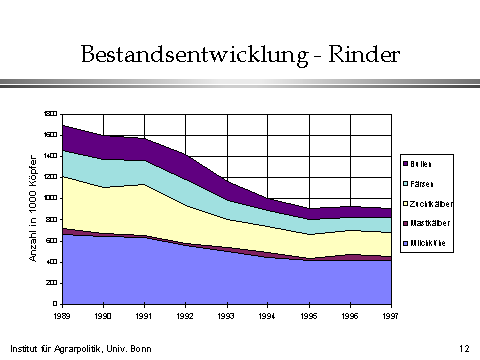
Quelle: Eigene Darstellung
Dieser hat sich in diesem Zeitraum fast halbiert. Der Bestand hat sich seit 1994 leicht stabilisiert, wobei nach einem erstmaligen Anstieg in 1995 der Endbestand im Jahre 96 wiederum rückläufig ist.
Für eine detaillierte Analyse und der Berücksichtigung einer jahresübergreifende Produktion werden Produktionsverfahren gebildet, die nach Alter, Geschlecht und Produktionsziel differenziert sind (Bullen, Färsen usw). Wesentliche Bestimmungsgrößen bei dieser Differenzierung sind die erzeugten aufzuchtfähigen Kälber, die Bestandsergänzung der Milchviehhaltung, der Anteil der Kälbermast und der Endbestand an Tieren des vorangegangenen Jahres. Die Aggregate dieser modellendogen bestimmten Umfänge entsprechen den Eckgrößen der Orginalstatistik. In dem vorliegenden Beispiel ist die Bestandsentwicklung in dieser Differzierung abgebildet.
In den Jahren 92 bis 94 wurde ein Kälberaufkommen von bis zu 0,6 aufzuchtfähigen Kälbern pro Kuh, einer Haltungsdauer der Kühe von vier Jahren und einer Verwendung von 30 % der Färsen für die Remontierung endogen ermittelt. Die 0,6 Aufzuchtkälber pro Kuh sind aber eher so zu interpretieren, daß ein Großteil der Kälber sehr früh geschlachtet wird und in keiner Statistik auftauchen. Hieraus kann man schließen das der eigentliche Kälberanfall doch bei 0,9 pro Kuh liegen muß, damit die Milchproduktion in entsprechender Höhe pro Kuh gewährleistet sein kann.
Der in 1996 diagnostizierte Bestandsabbau läßt sich aus dem Modellergebnissen erklären, da die vorhandenen Jungtiere nicht für den Bestandsaufbau ausreichen.
Die Erfahrungen bei der bisherigen Umsetzung von PIT haben gezeigt, daß es sinnvoll oder geradezu notwendig ist, daß verschiedene Insitutionen wie AKII, ASA, Uni Gödöllö und Uni Bonn zusammenarbeiten, um ein derartiges Informationssystem aufzubauen. An dieser Stelle möchte ich besonders Herrn Dr. Pitlik vom Lehrstuhl für Agrarinformatik dieser Universität danken, da er neben vielen Lösungen zur Datenverarbeitung besonders dazu beigetragen hat, daß die Methodik des differenzierten Analyseansatzes als Grundlage für ein Agrarsektormodell in Ungarn Verbreitung und Weiterentwicklung für die Belange der Transformationsländer findet. Durch diese Zusammenarbeit konnte bisher das Basismodell für die Jahre 94 bis 96 realisiert werden.
Die Vorteile bei der Wahl des Analyseansatzes zur Umsetzung des Basismodells lassen sich bisher wie folgt zusammenfassen:
- Zusammenführung verfügbarer Orginalstatistiken
- Berücksichtigung weiterer Informationsquellen zur Aufdeckung von Inkonsistenzen
- Dialog mit ungarischen Experten
- Schließen von Datenlücken
- Anpassungen im Konsistenzrahmen
- EU-vergleichbare Einkommensgrößen
- Wertschöpfungsbeiträge einzelner Verfahren
- Abbildung agrarsektoraler Verflechtungen
In Anbetracht der aufwendigen Erstellung, die Modelle dieser Art erfordern, ist zu hoffen, daß jetzt die Phase begonnen werden kann, in denen mit den erarbeiteten detaillierten Informationen Ex-post Analyse und Diagonse zu den agrarsektoralen Entwicklungen bzw. der Einsatz und die Entwicklung der Simulationsmodule erfolgen kann. Zu der Realisierung der Simulationskomponenten ist von ungarischer und deutscher Seite angestrebt die begonnene hervorragende Zusammenarbeit auszubauen, wenngleich die Schnelligkeit und Qualität dieser Realisierung davon abhängen inwieweit es uns gelingt Projekte für dieses Vorhaben zu erhalten. Neben der angestrebten Simulation erscheint es ebenfalls sinnvoll den Ansatz zu regionalisieren, wie es für das Beispiel RAUMIS vorgestellt wurde.
Hiermit möchte ich mein Refarat schließen, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe auf eine anregende Diskussion.
Az utolsó módosítás: 2005.05.29.
© miau